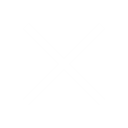JA! Ich starte eine Spendenaktion.
Das Prinzip ist ganz einfach: Sie starten ihre ganz persönliche Online-Spendenaktion auf dem Spendenportal betterplace.org und sammeln in Ihrem Namen zugunsten des Kinderpalliativzentrums in Ihrem Familien-, Freundes-, Mitarbeiter- oder Kundenkreis Spenden für schwerstkranke Kinder und ihre Familien.
Ob ein persönlicher Anlass, ein sportliches Ereignis oder ein Firmenevent: Ihre Kreativität ist gefragt - wir lassen uns gerne überraschen. Das Spendenportal betterplace.org ist selber gemeinnützig und nicht profitorientiert.
1. Profil erstellen und Spendenaktion anlegen
2. Familie, Freund*innen und Kolleg*innen einladen
3. Gemeinsam das Spendenziel erreichen